Greenwashing in der Modeindustrie
Greenwashing in der Modeindustrie
Nachhaltig, umweltbewusst, conscious − Das sind so Begriffe, wie sie uns täglich um die Ohren fliegen, in Geschäften, auf Instagram und in Newslettern. Denn es hat sich herumgesprochen, dass die Modeindustrie für zehn Prozent der CO2-Emissionen und für 20 Prozent der globalen Wasserverschmutzung verantwortlich ist. Davon möchten sich die einzelnen Marken natürlich distanzieren. Nur ist umweltbewusst produzierte Kleidung oftmals kostenintensiver. Können sich das Fast Fashion-Ketten, die zunehmend mit nachhaltigen Stoffen und fairen Arbeitsbedingungen werben, überhaupt leisten?
Greenwashing als Unternehmensstrategie
Mit „Greenwashing” waschen sich Unternehmen ihre Hände in Unschuld. Mit Hilfe von Marketingmaßnahmen versuchen sie sich ein „grünes Image“ zu verpassen, ohne entsprechende Maßnahmen im Rahmen der Produktion umzusetzen. Dadurch wird uns Verbrauchern Umweltfreundlichkeit und Unternehmensverantwortung vorgespielt.
Für viele Unternehmen ist das „Greenwashing” die erste Maßnahme, denn alles andere würde zu Gewinneinbrüchen führen: mit höheren Produktionskosten einerseits und anspruchsvolleren Verbrauchern andererseits. Denn ein nachhaltiger Lebensstil ist vor allem für junge Menschen immer wichtiger und Unternehmen mit einem umweltschädlichen Image werden gemieden. Ein nachhaltiger Konsum liegt sogar im Trend, hoffentlich einem langfristigen, der in die Normalität über geht.
Eine Umfrage der Unternehmensberatung PwC aus dem Jahr 2021 befragte 1.000 junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Knapp zwei Drittel der Befragten gaben an, dass Nachhaltigkeit eine Rolle beim Einkaufen spielt. Außerdem gaben 61 Prozent der Befragten hohe Preise als Grund an, weniger nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen.
Echter Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen sind nun mal teuer. Für Fast Fashion-Modelabels wäre eine komplette Überarbeitung des Geschäftsmodells notwendig, um tatsächlich einen positiven Beitrag zu leisten. Doch solche Investitionen bedeuten ein hohes Risiko für die Führungsebene und, zumindest in der Zeit des Umbruchs, sinkende Gewinnmargen. Wenn man bedenkt, dass die Verantwortlichen am kurzfristigen Unternehmenserfolg gemessen werden, wundert es kaum, dass die Marketingstrategie „Greenwashing” als Ausweg gewählt wird. Eine Kollegin erzählte mir neulich, wie eine Jeansmarken-Vertreterin sogar damit angab: „Wir betreiben jetzt auch Greenwashing”.
das Recyclingversprechen
Fast Fashion-Unternehmen werben gerne mit Recycling-Optionen. Kunden können ein altes Kleidungsstück zurückbringen und erhalten im Gegenzug einen Rabatt beim Neukauf. Die alten Kleidungsstücke werden im Nachgang recycelt, heißt es.
Das Problem ist nur, dass viele unserer Kleidungsstücke aus mehreren Materialien bestehen. Dies erschwert den Recyclingprozess enorm, macht ihn an manchen Stellen sogar unmöglich. Hinzu kommt, dass recycelte Stoffe auch nicht mehrfach recycelt werden können, meist nur ein einziges Mal. Denn bei diesem Prozess wird die Molekülstruktur aufgebrochen, was dazu führt, dass der Stoff irgendwann nicht mehr wiederverwendet werden kann.
Umweltschützerin Elizabeth Cline schätzt, dass weniger als ein Prozent der Kleidung wirklich recycelt wird und am Ende doch auf der Mülldeponie landet.
Vegan heißt nicht unbedingt nachhaltiger
Wenn wir sehen, dass ein Kleidungsstück als vegan gekennzeichnet ist, assoziieren wir das automatisch mit etwas Positivem und mit Nachhaltigkeit. Denn wer sich beispielsweise vegan ernährt, lebt bewusst und spart durch sein Essverhalten Emissionen ein. Leider kann man diese positive Wirkung auf die Umwelt nicht auf die Mode übertragen. Die Produkte aus synthetischen Alternativen zu Leder und Pelz werden nämlich oft aus Erdöl oder Polyurethan hergestellt, was sie nicht nachhaltiger macht.
Siegel wecken Vertrauen
Die Fülle an Siegeln und Logos, die uns ein nachhaltiges Produkt versprechen, ist kaum mehr zu überblicken. Viele davon decken nur einen kleinen Aspekt der Produktion ab, meist das Material und nur selten die gesamte Lieferkette. Daher entwickeln sich viele Standards weiter und nehmen zusätzliche Aspekte mit auf, was es den Unternehmen wiederum erschwert mitzuhalten. So kreieren einige von ihnen ihre eigenen Gütesiegel.
Das Projekt „Siegelklarheit“ der Bundesregierung gibt einen guten Überblick über Siegeln von verschiedenen Produktgruppen. Verbraucherorganisationen konzipierten es 2015 und entwickeln es kontinuierlich gemeinsam weiter. Mit dem Ziel, dem Verbraucher eine Orientierung bei der Vielzahl an Siegel-Angeboten zu geben, sodass nachhaltige Kaufentscheidungen ohne großen Aufwand in den Alltag integriert werden können.
Transparenz
Neben Qualitätssiegeln kann auch eine kurze Recherche helfen, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Wirbt ein Unternehmen zum Beispiel damit, bestimmte Kleidungsstücke seien aus Bio-Baumwolle oder recyceltem Material, kann es sein, dass dieses Material einen nur geringen Anteil ausmacht. Ebenso wird die Reduzierung von CO2-Emissionen oftmals als Ziel in Nachhaltigkeitsberichten ausgerufen. Leider veröffentlichen die wenigsten Unternehmen einen klaren Ablaufplan, wie dieses Ziel erreicht werden soll.
Ist ein Unternehmen wirklich nachhaltig und transparent, sollte man konkrete Informationen auf der Webseite finden. Oft genügt schon ein Blick aufs Etikett im Geschäft, um festzustellen, ob das Kleidungsstück wirklich das ist, was das Unternehmen verspricht.
Doch auch Transparenz ist kein Garant für Unternehmensverantwortung. Das Fast Fashion-Unternehmen H&M belegte im Fashion Transparency Index 2021 den zweiten Platz. Im Vorjahr wurde es sogar als Sieger gekürt. Grund genug, um das Modelabel genauer zu untersuchen.
Greenwashing am Beispiel von H&M
Transparenz ermöglicht Stakeholdern (Gesetzgebern, Arbeitnehmern, Investoren, Journalisten), Modemarken und Einzelhändler in die Pflicht zu nehmen. Durch das Veröffentlichen von Informationen zur Lieferkette, Arbeitsbedingungen, Materialien und Auswirkungen auf die Gesellschaft und Umwelt, setzen sich Modemarken freiwillig „unter Druck”, ihre ausgerufenen Ziele wirklich zu erreichen.
Transparenz ist eine hilfreiche Waffe gegen Greenwashing und ist ein Indikator für nachhaltiges Handeln. Es ist schlichtweg einfacher, Greenwashing zu betreiben, wenn keine Daten und Fakten ausgewiesen werden. Dennoch sollte man Transparenz nicht mit Nachhaltigkeit verwechseln.
2019 startete die norwegische Verbraucherzentrale eine Untersuchung gegen H&M mit dem Vorwurf des Greenwashings. Die stellvertretende Generaldirektorin der norwegischen Verbraucherschutzbehörde begründete den Verdacht damit, dass H&M dem Verbraucher keine genauen Informationen darüber gibt, warum bestimmte Kleidung mit dem Label 'Conscious' versehen wird. Daraus schlossen die Behörden, dass den Verbrauchern der Eindruck vermittelt wird, dass diese Produkte nachhaltiger sind, als sie es tatsächlich sind.
H&M definiert die Kriterien für die 'Conscious'-Kollektion folgendermaßen: „Jedes Conscious Choice Produkt besteht zu mindestens 50 Produkt aus nachhaltigeren Materialien wie Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester, bei vielen ist der Anteil sogar noch höher. Eine Ausnahme müssen wir bei recycelter Baumwolle machen: Hier dürfen es mindestens 20 Prozent sein.”
Bis 2030 sollen sogar alle Kollektionen zu 100 Prozent aus recycelten Materialien oder nachhaltigeren Materialien bestehen. Bereits heute ist nach Angaben des Sustainability Report 2021 des Unternehmens die verwendete Baumwolle zu 100 Prozent nachhaltig. Am gesamten Anteil der genutzten Baumwolle macht allerdings „Better Cotton” (BCI) 71.3 Prozent aus, sieben Prozent sind Recycling-Baumwolle und Bio-Baumwolle hat einen Anteil von 21,7. Was also ist genau BCI?
Better Cotton Initiative − BCI
Es lohnt sich, Begriffe wie „Better Cotton” zu prüfen. Denn auch die Better Cotton Initiative (BCI) kann nicht ganz frei von Kritik bleiben. Die BCI ist zwar eine Non-Profit-Organisation zur Schulung von Baumwollbauern, insbesondere in der effizienten Nutzung von Wasser, der Pflege der natürlichen Lebensräume und Verbesserung von Arbeitsbedingungen.
Kritiker bemängeln jedoch den Wirkungsgrad der Organisation. Die „bessere Baumwolle” hat mit Bio-Anbau nicht viel zu tun: Der Anbau ist immerhin Ressourcen-schonender als der konventionelle, da sie einen nachhaltigen Umgang mit Wasser und Böden und eine reduzierte Nutzung von Agrarchemikalien vorschreibt. Aber „Better Cotton” enthält vor allem gentechnisch veränderte Baumwolle.
Außerdem wird menschenwürdige Arbeit durch die BCI gefördert, aber nicht garantiert. Es geht unter anderem um existenzsichernde Löhne, Schutz im Fall von Krankheit und Schutz vor Ausbeutung. Ein Qualitätssiegel zu den vorherrschenden Arbeitsbedingungen ist das Logo der BCI leider nicht.
Synthetische Fasern
Neben den 60 Prozent Baumwolle im Gesamtmix ihrer Kollektionen verwendet H&M, wie fast alle anderen Modemarken auch, nach wie vor synthetische Fasern. Laut Unternehmensangaben sind es aktuell 20 Prozent Polyester und 3,3 Prozent Polyamide. Bei vielen anderen Marken kann das deutlich mehr sein, wohl gemerkt auch bei Luxusmarken wie Gucci oder Louis Vuitton (>>>). Da hilft ein Blick ins Materialetikett, bzw. in die Produktdetails der jeweiligen Onlineshops.
Das große Problem bei Kleidung mit Polyesterfasern ist das entstehende Mikroplastik. Winzige Fasern lösen sich immer wieder heraus. Beim Waschen gelangt Mikroplastik ins Abwasser. Kläranlagen können die winzigen Partikel jedoch nicht herausfiltern – so gelangen sie ins Gewässer und in die Umwelt. Polyester ist nicht biologisch abbaubar, es bleibt also lange bestehen. Für die Tier- und Pflanzenwelt ist das Mikroplastik eine erhebliche Belastung.
Ist es erst einmal in der Nahrungskette angelangt, landet es schließlich auch in unserer Nahrung. So wurde bereits Mikroplastik in Leitungswasser und Salz nachgewiesen. Außerdem nehmen wir mit jeder Mahlzeit winzige Plastikteilchen zu uns.
Zudem basiert Polyester auf Erdöl und damit auf einem nicht-erneuerbaren Rohstoff. Da die Reserven begrenzt sind, fördern Ölproduzenten zunehmend Öl aus sogenannten unkonventionellen Quellen, beispielsweise Ölsande in Kanada. Gigantische Waldflächen werden zur Förderung des Rohstoffs zerstört. Die Aufbereitung des Öls ist obendrein energieintensiv und verbraucht viel Wasser. Große Mengen giftiger Flüssigkeiten, die bei der Ölproduktion anfallen, gelangen in Flüsse und Gewässer und sogar ins Grundwasser.
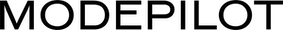
Newsletter
Photo Credit: Catwalkpictures










Kommentare