Neues vom Beauty Pro: Porentief nachgefragt
Aluminium in Deos, Parabene, Mineralöl & Co. – Vieles ist doch nicht schlimm
Vor vier Jahren waren die Medien voll von Warnungen über schädliche Inhaltsstoffe in Kosmetika. Parabene in Cremes, die Allergien auslösen sollen; Silikone im Shampoo, das Kopfhaut und Haare schädigen sollen und allen voran Aluminium in Deos, das Krebs erregen und Alzheimer fördern soll. Doch bis heute werden die vermeintlich kritischen Inhaltsstoffe von der Wissenschaft kontrovers diskutiert und sind sogar teilweise rehabilitiert.
In Folge dieser Negativ-Meldungen hat der Beauty-Trend „Clean Beauty“ deutlich an Fahrt aufgenommen. Von 500 Marken im Sortiment fallen bei dem Düsseldorfer Kosmetikriesen Douglas inzwischen rund 40 unter „Clean Beauty”.
"Saubere" Hersteller verzichten auf bedenkliche Inhaltsstoffe, darunter zyklische Silikone, Butyl- und Propylparabene, Sulfate und Mineralöl, schließen synthetische Bestandteile aber nicht aus. Genau darin besteht auch der Unterschied zu Naturkosmetik, die ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Will man dem Bericht glauben, den die British Soil Association Certification im Februar 2019 veröffentlicht hat, ist aus dem Nischentrend längst Mainstream geworden. Allen voran haben die Millennials und Gen Z dem Markt für Bio-Kosmetik und Wellness ein andauerndes Hoch verschafft.
Ist alles andere jetzt „Dirty Beauty”?
Was ist nun mit Aluminium in Deos?
Viel basiert auf sogenanntem „Angst-Marketing”, das dem Verbraucher suggeriert, dass alle Produkte, die es nicht in die Clean Beauty-Riege geschafft haben, automatisch bedenklich sind. Allen voran ist das mit Alu-Deos passiert. Aluminiumsalze werden in vielen Deodorants eingesetzt. Sie blockieren den Schweißfluss und hemmen die Geruchsbildung. Doch sie standen bereits seit Längerem in Verdacht, die Entstehung von Krebs begünstigen zu können. Da aufgrund der Nähe zur Achselhöhle das Brustgewebe besonders exponiert sei.
Forscher um Stefano Mandriota von der Universität Genf zeigten es an Versuchen mit Milchdrüsenzellen von Mäusen. „Wir wissen jetzt genug, um zu sagen, dass Aluminiumsalze toxisch sind“, ließ der Krebsforscher 2015 verlauten. Doch definitiv bewiesen war gar nichts. Die wenigen Untersuchungen zum Thema lieferten teilweise sogar widersprüchliche Ergebnisse. 2017 veröffentlichte die Medizinische Universität Innsbruck in der Fachzeitschrift „EBioMedicine“ eine epidemiologische Studie. Darin wurde die Korrelation aufgezeigt zwischen der sehr häufigen, mehrmals täglichen Verwendung aluminiumhaltiger Deos vor allem in jungen Jahren und der möglicherweise erhöhten Gefahr, später an Brustkrebs zu erkranken. Allerdings werteten die Forscher selbst dies noch lange nicht als endgültigen Beweis, dass Aluminiumsalze krebsauslösend sind.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gab 2019 vorsorglich eine Warnung über mögliche Gesundheitsrisiken heraus. Doch nun, im März diesen Jahres, belegte eine repräsentative Studie des unabhängigen wissenschaftlichen Beratergremiums SCSS der EU-Kommission, dass Aluminium in Deos doch nicht gesundheitsschädlich wirkt (>>>).
Aluminiumsalze im Körper
Trotzdem können nach heutigem Kenntnisstand zu hohe Aluminiumgehalte im Körper negative Auswirkungen auf das Nervensystem, die Nieren und die Knochen haben. Doch dafür ist nicht allein ein Alu-Deo verantwortlich zu machen, von dem man noch nicht mal genau weiß, wie viel der enthaltenen Aluminiumsalze die Haut tatsächlich durchqueren. Unbekannt ist auch, welcher Anteil des Aluminiums, das im menschlichen Körper nachgewiesen werden kann, aus Deos und ähnlichen Produkten stammt.
Auch weißende Zahnpasten enthalten beispielsweise Aluminium. Das BfR geht sogar davon aus, dass bei einem Teil der Bevölkerung die wöchentlich tolerierbare Aufnahmemenge bereits mit der Ernährung voll ausgeschöpft ist. „Wer sich grundsätzlich vor einer zu hohen Aluminiumaufnahme schützen will, sollte darauf achten, dass vor allem saure und salzhaltige Lebensmittel und Getränke nicht mit Aluminium in Kontakt kommen, etwa über Trinkflaschen, Backbleche und Grillschalen", heißt es vom Institut. Dazu gehören aufgeschnittene Äpfel, Tomaten, Rhabarber, Salzheringe, mariniertes Fleisch oder Käse.
Dermatologen geben Entwarnung
Unterhält man sich mit Dermatologen, geben die auch eher Entwarnung, was die Deo-Diskussion betrifft. „Jedes wirksame Antitranspirant enthält Aluminiumhydroxychlorid. Ansonsten handelt es sich um ein Deodorant mit fraglicher Wirkung (siehe Nuud >>>). Die Aluminiumkristalle verstopfen mechanisch die Ausführungsgänge der Schweißdrüsen, sodass die Achseln (oder Hand- und Fußflächen) trocken bleiben“, erklärt Dr. Christian Merkel vom Haut- und Laserzentrum in München.
„In den vergangenen 20 Jahren konnte von Wissenschaftlern kein kausaler Zusammenhang von Brustkrebs und der Anwendung von aluminiumhaltigen Antitranspirantien festgestellt werden. Aluminum wird in weit aus höheren Dosierungen durch Nahrungsmittel und andere Kosmetika aufgenommen. Im Jahr 2020 kann man daher davon ausgehen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Anwendung dieser Antitranspirantien und der Entstehung von Brustkrebs gibt.“
Reagiert jemand allergisch auf ein Deo, dann weniger auf das Aluminiumchlorid, sondern eher auf andere enthaltene Substanzen wie Duftstoffe. Worauf man allerdings achten sollte, ist, Deos mit Aluminium nicht auf gereizter oder verletzter Haut anzuwenden, weil dann mehr von den Aluminiumsalzen eindringen können. Deshalb empfiehlt sich das Rasieren der Achseln abends und nicht vor der morgendlichen Deodorierung.
Parabene besser als ihr Ruf
Parabene – Dieses Konservierungsmittel wird schon seit den Vierzigerjahren eingesetzt, um Kosmetika frei von Pilzen und Bakterien zu halten. Es wird aber auch in Zahnpasta, Deo, Shampoo und sogar in Lebensmitteln eingesetzt – eben überall, wo eine Verunreinigung drohen kann. Chemisch gesehen sind Parabene eine Bindung der para-Hydroxybenzoesäure (PHB-Ester). In der Natur kommen sie beispielsweise in Karotten oder Blaubeeren vor. Die Kosmetikindustrie stellt sie synthetisch her. In Verruf geraten sind sie 2004, als eine britische Studie Methylparabene mit Brustkrebs in Zusammenhang brachte.
Wissenschaftler hatten im Tumorgewebe Parabene nachgewiesen. Das Bundesamt für Risikobewertung fand, dass keine ausreichenden wissenschaftlichen Nachweise erbracht wurden und widerlegte die Studie. Doch der Schaden war angerichtet. In den Köpfen vieler Verbraucher hat sich die Meinung festgesetzt, Parabene seinen schädlich. Viele Kosmetikhersteller haben ihre Produkte umformuliert und Parabene durch einen anderen, oftmals weniger erforschten Konservierungsstoff ersetzt. Eine Stellungnahme des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): „Einen generellen Ersatz von Parabenen befürwortet das BfR nicht, weil diese Stoffe gut hautverträglich sind und im Gegensatz zu anderen Konservierungsmitteln ein geringes Allergierisiko bergen.“
Denn eines muss man wissen: Als Konservierungsstoffe sind Parabene besonders gut erforscht. Sie decken das gesamte Spektrum von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen ab und bleiben gleichzeitig hautverträglich. Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): „Um das ohne Parabene zu erreichen, müssten meist mehrere Substanzen kombiniert werden.“ Und mehr Stoffe bedeuten zugleich ein höheres Risiko für Kontaktallergien.
Silikone für den schönen Schein
Sie sind in Hautcremes, Make-up und Haarpflege enthalten. Kosmetisch gesehen sind Silikone völlig nutzlos, denn als hautfremde Stoffe haben sie keinen positiven Einfluss auf die Funktionsweise der Haut. Aber sie verbessern als ölige Komponente die Haptik des Produkts und sind ein preiswerter Ersatz für hochwertige, pflanzliche Öle. Doch während natürliche Öle die Hornschicht nähren, dichten Silikone die Oberfläche ab und sind mit der Reinigung wieder verschwunden. Allerdings gleiten silikonhaltige Produkte so schön auf der Haut und im Haar, und sie verursachen keine Allergien.
Deshalb erfreuen sie sich auch so großer Beliebtheit. Genauer betrachtet, sind Silikone Kunststoffe, eine Gruppe synthetischer Polymere, die im Labor hergestellt werden, oft unter Zufügen von Erdöl, weil dieses besonders gut versiegelt. Was sie können, ist den Haaren Glanz zu geben und angegriffene Strukturen durch eine vorübergehende Ummantelung auszubessern. Will man jedoch färben, ist gerade das kontraproduktiv, weil es die Aufnahme von Farbpigmenten verschlechtert. Doch trotz einiger positiver Aspekte sollte man auf Silikone verzichten, weil sie biologisch nicht abbaubar sind. Durch Kosmetik, Shampoos und andere Produkte gelangen sie tonnenweise ins Abwasser und damit in die Umwelt.
Mineralöl lässt die Haut nicht atmen
Bei Mineralölen denkt man eher an Tankstelle. Aber ebenso wie Paraffine sind sie nicht neu in der Beauty. Beide werden aus Erdöl hergestellt. Als Kosmetik-Grundstoff bieten sie mehrere Vorteile: Sie sind sehr haltbar und, anders als pflanzliche Öle, werden sie nicht ranzig. Außerdem sind sie kostengünstig und nicht allergen. Ihr Nachteil: Sie dichten die Haut ab und fördern den transepidermalen Wasserverlust, sprich die hauteigene Feuchtigkeit geht Stück für Stück verloren. Auch wenn sich die Haut anfangs gut damit fühlt, erzielt man nur einen kurzfristigen Effekt. Unter der Schutzschicht der Mineralöle bleibt die Haut genauso angespannt und gestresst wie zuvor. Langfristig kann sogar eine sogenannte „Mineralöl- oder Paraffinabhängigkeit“ entstehen – Man hat das Gefühl, ständig cremen zu müssen.
Gerade wer zu extrem trockener oder unreiner Haut neigt, sollte deshalb Mineralöle und Paraffine meiden. Der luftdichte Film auf der Haut kann Entzündungen verstärken. Achten Sie auf die Inhaltsstoffe Ihres Produkts. Wenn Sie einen der folgenden Begriffe entdecken, sind Mineralöle im Spiel: Mineral Oil, Vaseline, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Paraffinum Subliquidum, Cera Microcristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin.
Dass Mineralölen immer noch der Ruf anhaftet, gefährlich zu sein, ist auf eine Untersuchung der Stiftung Warentest vor fünf Jahren zurückzuführen. In 25 Produkten, die auf Mineralöl basieren, wurden kritische Substanzen festgestellt. Und zwar sogenannte aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz MOAH („Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons”), die als potentiell krebserregend gelten, und eigentlich aus dem Rohstoff ausgefiltert werden müssen. Dazu der IKW (Industrieverband Körperpflege und Waschmittel): „Verbraucher können kosmetische Produkte, die Mineralöle enthalten, bedenkenlos benutzen. Alle verwendeten Rohstoffe müssen umfangreich geprüft werden und höchste Standards in Bezug auf Reinheit und Qualität erfüllen.“ Mehrere Studien belegen auch, dass Mineralöle als Inhaltsstoffe in kosmetischen Mitteln gesundheitlich unbedenklich und sicher sind. Wer sich darauf nicht verlassen will, greift besser zu „Clean Beauty“.
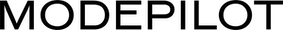
Newsletter
Photo Credit: Catwalkpictures








Kommentare
Auf Aluminium (Dosen, Kaffeekapseln usw.) verzichte ich übrigens seit einer Islandreise gerne. Dort habe ich gelernt, dass das gesammelte Alt-Alu komplett per Schiff nach Island gebracht wird, wo die letzte europäische Aluminiumschmelz- und -wiederaufbereitungsanlage steht. Mitten in der noch intakten Natur, direkt am Rand des Ozeans, werden gepresste Quader des Altmetalls bei über 1000°C verflüssigt und wieder nutzbar gemacht. Und das Ding steht deshalb in Island (und verpestet dort jahrhundertealte Moose und Co.), weil diese hohen Temperaturen extrem viel Energie benötigen, und Strom in Island am billigsten in ganz Europa ist, weil es durch Natur-Kraftwerke (Wasserfälle, Wind, Gezeiten und Sonne) genug kostenlos nutzbare Energie gibt.