Neues vom Beauty Pro: Porentief nachgefragt
Wenn unsere Haut zu viel Feuchtigkeit verliert…
Feuchtigkeit binden − aber wie? Wer unter trockener Haut leidet, leidet unter einem transepidermalen Wasserverlust. Damit gemeint ist der Wasserdampf, der von der Dermis zur Epidermis gelangt und von der Hautoberfläche nach außen verdunstet.
TEWL ist die Abkürzung und steht für TransEpidermal Water Loss, also transepidermalem Wasserverlust. Den gibt es nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren und Pflanzen. Grundsätzlich ist der Verlust von Feuchtigkeit ein völlig natürlicher Vorgang. Er ist Teil des normalen Hautstoffwechsels. Unser Körper besteht bis zu 70 Prozent aus Wasser und gibt jeden Tag eine bestimmte Menge davon an die Umwelt ab. Das Ausmaß hängt von vielen Faktoren ab.
Wie viel wir von unserem Wasser über die Haut an die Umwelt abgeben, variiert je nach Umweltbedingungen, Jahreszeit, körperlicher Betätigung, Außentemperatur. Auch individuelle Faktoren wie Geschlecht, Hauttyp, Hauttemperatur, Raucherstatus und Alter nehmen Einfluß. Um das lebensnotwendige Wasser in der Haut zu binden, stehen ihr zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Das sind einmal die natürlichen Feuchtigkeitsspender und andererseits die Fette der Hautbarriere, die die Wasserverdunstung verhindern.
Der Tewameter
Gemessen wird der TEWL üblicherweise in g/m²/h. Bei gesunder Haut liegen die Werte zwischen 2,3 g/m²/h auf der Brust und 44,0 g/m²/h in den Achselhöhlen. Im Gesicht, zum Beispiel an der Wange, misst man im Durchschnitt 13,9 g/m2/h. Ältere Menschen wiederum weisen durchweg geringere Werte auf, während sie bei Narbengewebe auf 50 oder sogar über 100 g/m²/h ansteigen. Ermittelt wird der TEWL mit dem Tewameter. Das elektronische Gerät ist mit zwei Sensorenpaaren für Temperatur und Feuchtigkeit ausgestattet, die in einem Hohlzylinder angebracht sind. Damit kann die Wasserabdampfungsrate von der Haut direkt bestimmt werden. Kosmetikhersteller beispielsweise nutzen die TEWL-Messung häufig, um bei neuen Formulierungen die Wirkung von Feuchtigkeitsbindern über einen längeren Zeitraum zu testen.
Warum misst man den TEWL?
Wenn der Wasserverlust normal ist, muss man doch gar kein Aufheben darum machen, könnte man meinen. Ist der TEWL jedoch erhöht, sagt das Einiges über den Hautzustand aus und vor allem, dass die Hautbarriere nicht mehr intakt ist. Eine geschädigte Hautbarriere lässt mehr Wasser nach außen durch. Ist das Klima sehr trocken, beispielsweise im Sommer oder im Winter in geheizten Räumen, bedeutet das Stress für die Hautbarriere. Denn ganz klar, sobald die Temperaturen sinken, produzieren die Talgdrüsen weniger Fett. Fehlt dieser schützende Film auf der Hautoberfläche, kann Feuchtigkeit noch schneller verdunsten. Speichert die Haut weniger Wasser, funktioniert auch die Zellabstoßung nicht mehr reibungslos. Infolge spannt die Haut, sie juckt und es können sich sogar kleine Risse bilden. Ein langanhaltender Feuchtigkeitsverlust bedeutet eine dehydrierte Haut und das wiederum bedeutet feine Linien, Falten und einen glanzlosen Teint.
Auch die falschen Kosmetika können die Hautbarriere schädigen. Damit gemeint ist die äußerste Schicht unserer Haut. Ihre Funktionen ist der Schutz der Haut vor Umwelt-Aggressoren, Schadstoffen und UV-Licht. Ihre Zellen sind umgeben von einem flüssig-kristallinen Gemisch aus Wasser und Fetten. Zu ihren schlimmsten Feinden von außen gehören Tenside. Das sind waschaktive Substanzen (Detergentien), die in Waschmitteln, Spülmitteln und Haarwaschmitteln enthalten sind. Sie denaturieren, d.h. verändern das Protein in der Hautbarriere und zerstören die natürlichen Feuchthaltefaktoren. Dieses Gemisch aus Stoffwechselprodukten wie Harnstoff, Milchsäure und Aminosäuren in der Hornschicht trägt zur natürlichen Feuchtigkeitsbindung bei, die die Haut geschmeidig hält und verhindert, dass sie austrocknet. Sie werden unter dem Begriff NMF − Natural Moisturizing Factor − zusammengefaßt.
Wie können wir unsere Haut unterstützen?
Auf alle Fälle mit sanfter Reinigung und einer Pflege mit Wirkstoffen, die das natürliche Feuchthaltesystem unserer Haut unterstützen und Feuchtigkeit binden. Man findet sie in vielen Pflegeprodukten, wie Seren, Cremes oder Gels. Sie enthalten Feuchtigkeitsspender wie Glycerin, Hyaluronsäure und den „guten“, mehrwertigen Alkohol Pentylenglycol. Dieser trocknet nicht aus wie seine aggressiven „Kollegen“, sondern sorgt für Feuchtigkeit und konserviert gleichzeitig das Produkt. Auch Ceramide leisten gute Dienste. Es sind Lipide (Fette), die auch auf natürliche Weise in der Haut vorkommen. Sie machen circa 50 Prozent der Hautzusammensetzung aus. Ihr Verdienst ist es, dass mehr Feuchtigkeit gespeichert werden kann. Phosphatidylcholin ist ein weiteres Lipid, das für eine starke, gesunde Hautbarriere zuträglich ist. Als Bestandteil jeder Zelle wird es zu vielen Bausteinen verarbeitet, die die Hautbarriere stärken und ihre Regeneration aktivieren.
Cremes für trockene Haut enthalten deshalb auch meist mehr Fette, weil sie die Haut abdichten und die Feuchtigkeit einschließen. Man spricht von einem Okklusiv-Effekt. Allerdings hemmt der auch die natürlichen Abläufe in der Haut. Unbedingt vermeiden sollte man extrem potente „Dichtstoffe“ wie Mineralöle und Silikone. Denn wenn gar keine Feuchtigkeit mehr entweichen kann, können sich Hautprobleme wie Akne und Rosazea unter der Abdichtung verschlimmern. Deshalb ist es besser, eine Creme mit natürlichen Fetten wie Sheabutter oder Squalan zu benutzen. Denn ein balancierter TEWL garantiert schöne geschmeidige Haut.
Mehr von unserer Autorin Margit Rüdiger lesen Sie jeden Freitag hier auf MODEPILOT.de – Ihre bisherigen Kolumnen gibt es hier >>> und mehr auf ihrem Blog Culture & Cream (>>>) Fragen, Wünsche, Feedback? Sie erreichen unsere Kolumnistin unter beautypro[@]modepilot.de
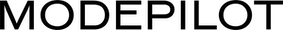
Newsletter
Photo Credit: Catwalkpictures







Kommentare